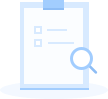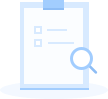Die „kleinen Fächer“ sind kein klar definierter Begriff. Sie sind durch ihre relativ geringe Ausstattung gekennzeichnet und stehen deshalb im Rahmen einer Medizinischen Fakultät quantitativ nicht im Mittelpunkt von Forschung und Lehre. Insofern besteht in Zeiten knapper Ressourcen die Tendenz, die Notwendigkeit betreffender Institute infrage zu stellen. Vor allem Fächer, die im weiteren Sinne sozialmedizinisch ausgerichtet sind und nicht auf der molekularen Biomedizin aufbauen beziehungsweise kein klinisches Hauptfach vertreten, sind potenziell vom „Aussterben“ bedroht. Wie im Beitrag dargelegt wird, trifft dies jedoch weniger auf den mit der Approbationsordnung von 2002 neu eingeführten Bereich „Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin“ (GTE) zu, der an fast allen Medizinischen Fakultäten mit eigenständigen, allerdings sehr unterschiedlich ausgestatteten Abteilungen etabliert ist. Der vorliegende Beitrag soll einen Einblick in die gegenwärtige, zum Teil kontrovers diskutierte Situation von GTE geben und seine Bedeutung für die ärztliche Ausbildung und das wissenschaftliche Selbstverständnis der Medizin aufzeigen. Demnach sind die medical humanities als integraler Ort der kritischen Selbstreflexion der Medizin für Medizinische Fakultäten unverzichtbar – letztlich auch im Hinblick auf die Krankenversorgung.