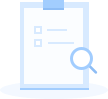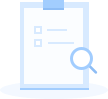Pharmakogenetische Faktoren wirken sowohl auf
pharmakokinetische als auch auf pharmakodynamische Prozesse.
Genetische Polymorphismen von Arzneimittel-metabolisierenden
Enzymen, Transporterproteinen und den pharmakologischen
Zielstrukturen beeinflussen die individuelle
Dosis-Wirkungs-Beziehung maßgeblich. Sie können für die
Wirkungslosigkeit von Arzneimitteln oder auch für potenzielle
Nebenwirkungsreaktionen verantwortlich sein. Entsprechend gibt
es eine Reihe von Richtlinien zur Anwendung der Pharmakogenetik
in klinischen Studien. Sie empfehlen den Sponsoren, die
Auswirkung genetischer Polymorphismen auf die Pharmakokinetik,
die Dosis-Wirkungs-Beziehung und die
Arzneimittelwechselwirkungen zu untersuchen. Weiterhin sollten
interethnische Unterschiede analysiert werden,um Rückschlüsse
auf die Übertragbarkeit der in den Studien gewonnenen Daten auf
andere Populationen zuzulassen. Gegenwärtig werden
pharmakogenetische Untersuchungen meist nur im Zusammenhang mit
klinischen Phase-I-Studien durchgeführt, die resultierenden
Erkenntnisse werden jedoch selten auf die Phase II bzw. Phase
III übertragen. Mit der zunehmenden Bedeutung und Umsetzung der
Pharmakogenetik wird auch die Menge an detaillierten genetischen
Daten zunehmen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass damit
auch der Bewertungsprozess eines Arzneimittels und die
entsprechenden Verschreibungsempfehlungen sehr viel komplexer
werden. Allerdings lassen sich nicht alle
Arzneimittelreaktionen, die außerhalb der Norm liegen, auf
genetische Polymorphismen zurückführen. Sie können auch durch
nicht-genetische Faktoren begründet sein. Es würde aber viel vom
Potenzial der Pharmakogenetik verschwendet, wenn Ärzte
Genotyp-orientierte Verschreibungsempfehlungen unberücksichtigt
ließen.